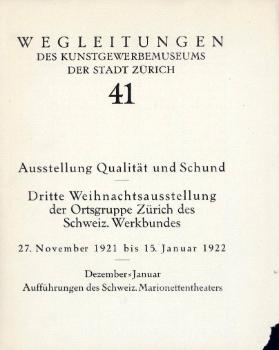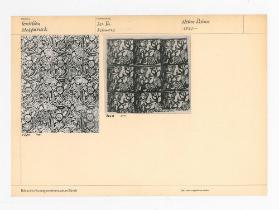Helen Dahm

Helen Dahm
* 1878 in Egelshofen; † 1968 in Männedorf
1883 Zeichen- und Malunterricht bei Max Joseph von Sury
1897 Hospitantin an der Kunstgewerbeschule Zürich bei Hermann Gattiker, Wilhelm Hummel und Ernst Würtenberger
1899 Besuch der Luise-Stadler-Schule Zürich (“Frauenkunstschule”)
1903 Teilnahme an Turnus-Ausstellungen des Schweizerischen Kunstvereins
1906 Auswanderung nach München und Privatschulunterricht bei Robert Engels, Julius Exter und Moritz Heymann
1908 Mitglied der Schweizer Grafikkünstlervereinigung Die Walze
1913 Rückkehr nach Zürich
1916 erste umfassende Einzelausstellung in eigenem Atelier in Zürich
1917 Mitglied des Schweizerischen Werkbunds
1919 Umzug nach Oetwil am See
1928 Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft Bildender Künstlerinnen; Teilnahme an der ersten Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit (SAFFA) in Bern
1938 einjähriger Aufenthalt in Indien
1953 erste umfassende Retrospektive im Helmhaus Zürich, Durchbruch zum Erfolg als Künstlerin
1954 Kunstpreis der Stadt Zürich
1958 Teilnahme an der SAFFA 1958 in Zürich
1963 Retrospektive im Kunsthaus Zürich
1964 Werkbeitrag für die Schweizerische Landesausstellung Expo 64 in Lausanne
Helen Dahm wuchs in einer bürgerlichen Familie auf und nahm schon als Kind Zeichenunterricht bei Max Joseph von Sury. Trotz ihres ausgeprägten Traums, Malerin zu werden, musste sie den Wunsch lange Zeit hintanstellen und familiären Verpflichtungen nachkommen. Als Frau von staatlichen Akademien und Kunsthochschulen abgelehnt, bildete sie sich in Abendkursen der Kunstgewerbeschule Zürich und später an der privaten “Frauenkunstschule” von Luise Stadler künstlerisch weiter, vor allem im grafischen Fach. 1906 zog Helen Dahm nach München, um sich der Kunst zu widmen und nahm Unterricht an der Kunstakademie für Frauen sowie der Schule für zeichnende Künste und Malerei. Dort kam sie mit der Künstlergruppe Der Blaue Reiter in Kontakt, deren expressionistisches Schaffen Helen Dahms Werk fortan beeinflusste. 1913 kehrte sie nach Zürich zurück und bestritt ihren Lebensunterhalt mit kunstgewerblichen Arbeiten. In dieser Zeit entstanden zahlreiche expressionistische Holz- und Linolschnitte, die als Textildrucke Anwendung fanden. Die mit stilisierten Pflanzenornamenten und linearen Figurendarstellungen verzierten Stoffe verkaufte sie unter anderem in der Zürcher Genossenschaft für Kunst von Frauen, Die Spindel. Die Textilien zeugten überdies vom Reformgedanken des Schweizerischen Werkbunds, dessen Mitglied Helen Dahm 1917 wurde, und von ihrem gestalterischen Anspruch, nicht nur dekorieren, sondern das Leben bereichern zu wollen. Ab 1919 löste sie sich gänzlich vom Kunstgewerbe und widmete sich vollumfänglich ihrer Selbstfindung in der Malerei. Erst spät wurde ihr als Frau die künstlerische Anerkennung in Fachkreisen zuteil – 1954 erhielt sie dann als erste Frau überhaupt den Kunstpreis der Stadt Zürich. Bis zu ihrem Tod im Jahr 1968 entwickelte sich ihr Œuvre über einen freien Umgang mit Material und Technik von expressionistischen Gemälden und Drucken bis hin zu gegenstandsloser, informeller Malerei. Helen Dahm schuf über 2200 Werke und zählt heute zu den wichtigsten Schweizer Künstlerinnen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Quellen:
Wild, Doris, Elisabeth Grossmann, Regula Witzig, “Helen Dahm. Monographie”, Zürich 1984
Hoch, Stefanie, Markus Landert, Regula Tischhauser (Hg.), “Helen Dahm. Ein Kuss der ganzen Welt”, Zürich 2018
www.helen-dahm.ch